Supervision
Pflege fordert auch emotional und mental
Pflegekräfte stehen täglich unter hohem Druck: Zeitmangel, Schichtarbeit, körperliche Belastung und der Umgang mit schweren Schicksalen gehören zum Berufsalltag. Laut einer Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, 2018) leiden 82 % der Pflegenden unter mindestens einer psychosomatischen Beschwerde.
Wo Supervision ansetzt
Das Konzept der Supervision stammt ursprünglich aus der sozialen Arbeit. Im Fokus steht die Reflexion beruflicher Beziehungen und Rollen zwischen Individuum, Organisation und Klient:innen. Für die Pflege bedeutet das: Supervision schafft Raum, um schwierige Situationen zu besprechen, Konflikte zu klären und die eigene Rolle bewusst zu reflektieren.
Team stärken: Belastungen reduzieren
Dauerhafter Stress wirkt sich nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf die Teamdynamik aus. Unter Druck entstehen schneller Missverständnisse und Konflikte. Supervision hilft, diese Spannungen frühzeitig wahrzunehmen und gemeinsam Lösungen zu finden bevor sie zur zusätzlichen Belastung werden.
Formen der Supervision in der Pflege
In der Pflegepraxis haben sich zwei Formen der Supervision etabliert: Teamsupervision und Fallsupervision.
Die Teamsupervision unterstützt Pflegeteams dabei, gemeinsam Herausforderungen zu reflektieren, Konfliktursachen zu erkennen und praxisnahe Lösungen zu entwickeln, begleitet durch professionelle Supervisor:innen. Sie fördert Kommunikation, Zusammenarbeit und stärkt den Zusammenhalt im Team.
Ein gut funktionierendes Team wiederum hilft den Einzelnen, besser mit den körperlichen und psychischen Belastungen im Pflegealltag umzugehen.
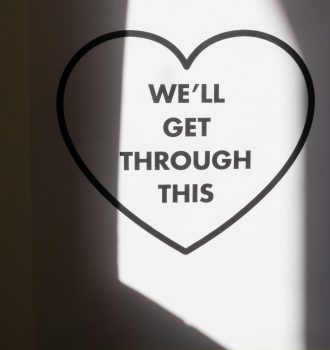
Supervision in der Pflege: Raum für Austausch und Entlastung
Supervision bietet Pflegeteams die Möglichkeit, herausfordernde Situationen, ob im Team oder im Umgang mit Patient:innen gemeinsam zu reflektieren. In sogenannten Fallsupervisionen können persönliche Erfahrungen in geschützter Atmosphäre besprochen werden, im Sinne einer kollegialen Beratung.
Das stärkt nicht nur den Teamzusammenhalt und das gegenseitige Verständnis, sondern sorgt auch für emotionale Entlastung im oft belastenden Pflegealltag. Studien zeigen, dass Pflegende Supervision als hilfreiche Unterstützung empfinden, trotz des damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwands (Wittich, 2004, Universitätsklinikum Freiburg).
Quellen:
- Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) (2018). Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege. Höhere Anforderungen, mehr gesundheitliche Beschwerden. https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fakten/BIBB-BAuA-31.html
- Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) e.V. (2017). Berufsbild Psychologie (4.Aufl.). https://www.bdp-verband.de/binaries/content/assets/beruf/berufsbild.pdf
- Domnowski, M. (2010). Burnout und Stress in Pflegeberufen. Mit Mental-Training erfolgreich aus der Krise (3. Aufl.). Schlütersche Verlag: Hannover.
- Holzapfel, J. (2022). Teamentwicklung in Kliniken: Interviewstudie zur Erfassung von Maßnahmen für die Unterstützung von Teams vor dem Hintergrund der Corona Pandemie. (unveröffentlichte Bachelorarbeit, Wirtschaftspsychologie). Hochschule für Technik, Stuttgart.
- Nando, B. (2018). Supervision und Coaching. Grundlagen, Techniken, Perspektiven (5.Aufl.). Verlag C.H. Beck: München.
- Wittich, A. (2004). Supervision in der Krankenpflege: Formative Evaluation in einem Krankenhaus der Maximalversorgung [Diss.]. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau.
